Thomas Michalak, ebenfalls mit den Mitteln der Fotografie arbeitender Künstler, lernte Lips anläßlich einer Ausstellung 1987 in Berlin kennen. In den letzten beiden Lebensjahren von Lips intensivierte sich die Freundschaft noch einmal, Michalak half bei der Organisation von Ausstellungen und began das Archiv zu ordnen. Den folgenden Text schrieb er kurz nach dem Tode von Lips für die Zeitschrift "Magnus".
Thomas Michalak
Roger Lips 1952 - 1994
Vor beinahe acht Jahren lernte ich den Kölner Fotografen Roger Lips anläßlich seiner Ausstellung "Positiv-Negativ" im Berliner Café "Anderes Ufer" kennen. Die Wände des Cafés waren damals mosaikartig mit zwei Postkarten des Künstlers, einem roten und einem grünen Kopf, beklebt. Ein Jahr später konnte ich eine umfangreichere Ausstellung seiner Arbeiten in der "Fotogalerie im Wedding", die ich gemeinsam mit den Fotografen Ingo Taubhorn, Thomas Rohloff und Werner Land betrieb, zeigen. Seither verband mich eine langsam wachsende Freundschaft mit diesem stillen, sensiblen, dann auch wieder impulsiven und kompromißlosen Menschen Roger Lips.
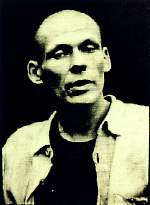 |
Dieses Selbstporträt fertigte Roger Lips 1993 nach einem Foto von Thomas Michalak. | |
Obwohl Roger Lips' Werk in den achtziger Jahren in vielen Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich war und einige seiner Arbeiten in bedeutenden Sammlungen vertreten sind, ist sein Name und sein Werk außerhalb des Kölner Raums nur wenigen ein Begriff. Ein Grund für mich, diesen Beitrag nicht als Nachruf zu gestalten, sondern das Werk Roger Lips' anhand einiger wichtiger Arbeiten noch einmal im Ansatz vorzustellen.
Roger Lips wurde an der Folkwangschule in Essen zum Designer ausgebildet. Von der Graphik kam er zur Fotografie, bezeichnete seine Arbeit eine Zeitlang auch programmatisch als "Foto-Graphik", suchte neue Formen in der Verbindung beider Medien. Mitte der achtziger Jahre, die Zeit, in der sein Hauptwerk entstand, war der theoretische Streit um Fotografie als Kunst in vollem Gange. Heute, wo es fast selbstverständlich ist, daß bildende Künstler sich auch fotografischer Mittel bedienen und Arbeiten zeitgenössischer Fotografen kunstmarktfähig geworden sind, ist kaum noch nachzuvollziehen, daß seine Arbeit sowohl auf Seiten der herkömmlich abbildenden Fotografie als auch in den angestammten Bereichen der bildenden Kunst Befremden auslöste.
 |
 |
|
| Zwei aus der Reihe der Köpfe aus dem Jahr 1986 | ||
Eine wichtige, immer wieder gezeigte Werkgruppe sind die Köpfe, früher von Lips als Porträts bezeichnet, die Mitte der achtziger Jahre entstanden. Ausgangspunkt sind oft anonym aufgenommene Bilder junger Männer. Durch extreme Vergrößerungen, chemische und mechanische Bearbeitungen des Diapositivs, vielfaches Um- und auch Übereinanderkopieren ihrer Persönlichkeit beraubt, werden diese Bilder zu einer Art Ikone. Gebrochene, zerstörte Ikonen allerdings: Erotisch aufgeladen mit den Projektionen sowohl des Künstlers als auch des Betrachters, werden sie doch nicht verfügbar und lassen durch den destruktiven, dekonstruierenden Duktus des Künstlers eine starke Spannung zwischen Zuneigung, Sehnsucht, Wut und Zerstörung spürbar werden.
Etwa zur selben Zeit entstanden einige Einzelbilder von Männergruppen. Ebenfalls mit den oben genannten Techniken ihres dokumentierenden Gehalts beraubt, scheinen sie sich mit den Phantasien des Betrachters zu verbinden und eine mann-männliche Ritualität zu behaupten, die den Ritualen schwuler Subkultur vorausgeht und sie übersteigt.
 |
Bilder wie dieses wurden von Lips "Szenen" oder "Szenerien" genannt. |
Um tiefer verwurzelte Formen scheint es hier zu gehen, die, vorsichtig gemutmaßt, dem Künstler interessanter, kraftvoller, erstrebenswerter schienen und als mögliches Gegenbild zur subkulturellen schwulen Interaktion zumindest befragt wurden.
Immer wieder setzte sich Roger Lips mit seiner ihm frühzeitig bekannt gewordenen HIV-Infektion auseinander. Unter dem Arbeitstitel "positiv-negativ" entstanden eine Reihe von Bildern, in denen, dem Wortsinn folgend, ein Diapositiv mit einem Schwarzweißnegativ gemeinsam vergrößert wurde. Anders als in den bisherigen Arbeiten wurden die Protagonisten hier nicht mehr aus der Distanz fotografiert, sondern die Teilbilder sind mit Bekannten und Freunden in gemeinsamen Sitzungen inszeniert. Auch inhaltlich spiegelt sich die größere Nähe zum Objekt. Elemente tänzerischer und schauspielerischer Selbstinszenierung: Wir erleben Hingabe, Geborgenheit und Schutz. Ihren Höhepunkt finden Sandwichtechnik, also das Übereinanderlegen verschiedener Diapositive, und Doppelbelichtung in einem großen als Triptychon angelegtem Tafelbild, dessen Mittelteil an christliche Kreuzigungsdarstellungen erinnert.
| Die Seitenflügel entstanden 1986, der Mittelteil kam 1990 hinzu. |  |
 |
 |
In den 90er Jahren verlieren die Abstraktionstechniken für Roger Lips an Bedeutung. Er wendet sich dem Porträt zu, fotografiert Nähe und Erotik, die zwischen zwei sich liebenden Menschen entstehen kann. Ein wichtiges Thema wird der Tanz als direkter körperlicher Ausdruck von Befindlichkeit. Und noch einmal setzt er sich mit Aids und den Gesetzen schwuler Subkultur auseinander, die er als lieblos und mechanisch empfindet. In einem beeindruckenden Triptychon kontrastiert er eine Vielzahl einem Porno entnommener "Blow-Jobs" mit dem warmgetonten Bild zweier Unterarme und Hände, die gebend wie empfangend zueinander geöffnet sind.
Die Ambivalenz, das Befragen von Möglichkeiten in den früheren Arbeiten ist in den Arbeiten dieser Gruppe einem eindeutigen moralischen Standpunkt gewichen.
Die letzte Arbeit von Roger Lips, ein paar Monate vor seinem Tod fertiggestellt, beeindruckt mich deshalb so sehr, weil sie sich am Lebensende wieder der Kindheit zuwendet. In diesen letzten Schwarz-Weiß-Arbeiten kehrt Roger Lips auch wieder zu den alten Bearbeitungstechniken zurück. Zu sehen sind 20 Gesichter des Kleinkindjungen Noah. Die Augenhöhlen bleiben schwarz. Seltsam leer erinnern sie an Totenschädel. In jedem dieser leicht unscharfen, durch die Brauntonigkeit an eigene, alte Kinderbilder erinnernden Fotografien wird die Gefährdung und scheinbare Willkürlichkeit lebendiger menschlicher Entwicklung spürbar. Hier ist der Moment, an dem das Kind noch alle Möglichkeiten in sich zu tragen scheint, seine gesellschaftliche und individuelle Formung indes, Wurzel allen späteren Glücks und Unglücks, bereits begonnen hat.
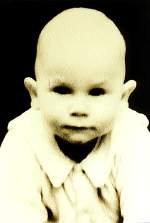 |
 |
|
| Zwei aus der Reihe der 20 Bilder umfassenden letzten Arbeit von Lips aus dem Jahr 1994 | ||
Roger Lips starb am 27. Dezember 1994 an den Folgen von AIDS.
Thomas Michalak, Köln 1995

